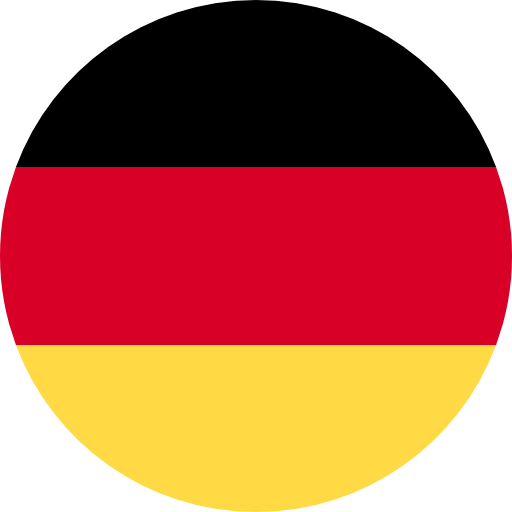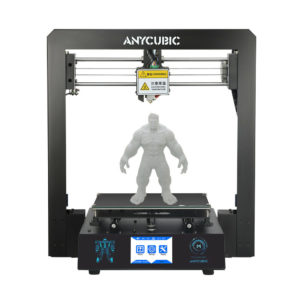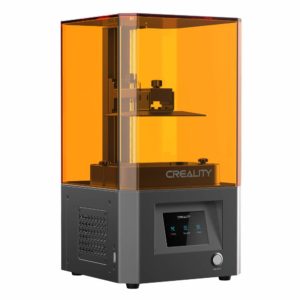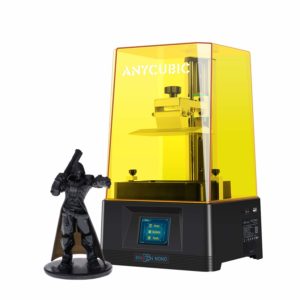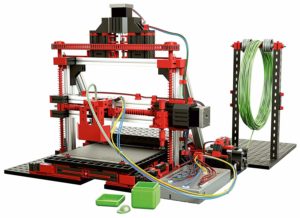Herr Masie – wie lernen wir im Jahr 2030? Werden wir alle mit 3D-Brillen herumsitzen und uns in komplett virtuellen Lernumgebungen bewegen?
Zuallererst möchte ich betonen, dass sich Technologien so schnell verändern, dass eine verbindliche Aussage über die nächsten zwei Jahre hinaus nicht möglich ist. Was ich aber mit Gewissheit sagen kann: Lernen wird spannend sein und sich stark von heutigen Konzepten unterscheiden.
Könnten Sie das näher erläutern?
Wir werden Wissen zunehmend aus der Cloud beziehen. Die Art und Weise, wie wir Wissen erwerben und teilen, wird sich grundlegend verändern. Es wird überall zugänglich sein. Wenn beispielsweise eine Problemstellung auftritt, die im Kollegenkreis nicht gelöst werden kann, kann der Mitarbeiter auf digitaler Ebene direkt eine Frage stellen und erhält sofort eine maßgeschneiderte Antwort.
Ist das die „Personalisierung des Lernens“, die Sie in Ihrer Keynote thematisieren werden?
Ja, schauen wir uns als Beispiel eine Weiterbildung für Marketing-Manager an. Einsteiger werden viel mehr Grundlagenwissen benötigen als Marketing-Experten, die den Job seit 30 Jahren ausüben oder über entsprechende Hochschulabschlüsse verfügen. Das ist bekannt. Der neue Aspekt betrifft die Wissensquellen: Anstatt nur zwei oder drei Artikel zu einem Thema haben die Teilnehmer Zugriff auf Zehntausende von Artikeln und Grafiken. Künstliche Intelligenz wird Ihnen und mir ganz unterschiedliche Antworten bereitstellen, denn wir unterscheiden uns stark darin, welche Inhalte wir benötigen, wie wir lernen und wo unsere Wissenslücken sind. Wir müssen nicht mehr stundenlang nach der richtigen Antwort suchen. Die Maschine wählt auf Basis dessen, was sie über uns weiß, die richtigen Informationen für uns aus. Damit erhält jeder einen individuellen Zugang zum benötigten Wissen.
Das hört sich sehr zeitaufwändig und teuer an.
Ganz im Gegenteil. Mit Hilfe von Simulationen kann das Lernmaterial sogar deutlich reduziert werden. Im Moment probieren wir Dinge aus, bevor wir sie anwenden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Sie fahren ein teures Elektroauto, beispielsweise einen Tesla. Sie stellen fest, dass zwei Reifen zu wenig Luft haben. Sie fahren zur Werkstatt, nehmen den Druckluftautomaten vom Haken, öffnen ein Ventil – aber dann müssen Sie herausfinden, wieviel Luft Sie auffüllen müssen. Sollten Sie die Reifen etwas mehr aufpumpen als im Handbuch empfohlen, weil Sie schweres Gepäck im Kofferraum haben? Liegt der niedrige Reifendruck an den kalten Temperaturen? Anstatt auszuprobieren, können Sie eine Simulation nutzen. Mit Hilfe eines Touchscreens können Sie die Simulation starten, und das System sagt Ihnen dann ganz genau, wie viel Luft in die Reifen gefüllt werden muss. In Zukunft werden Simulationen Teil unseres alltäglichen Lebens.
Aber wo kommt das Wissen her?
Von Menschen. Wir werden mit Menschen, die wir als Experten schätzen, enger verbunden sein als heute. Wenn man beispielsweise für eine Versicherungsgesellschaft arbeitet und einen komplizierten Vorgang bearbeiten muss, benötigt man die Unterstützung von einer verlässlichen, vertrauenswürdigen Person. Normalerweise wendet man sich direkt an einen Kollegen, der aber vielleicht auch nicht die richtige Antwort hat. In der Zukunft ist der Experte nur einen Klick entfernt. Auf dem Screen erscheint beispielsweise ein Kollege aus Afrika oder Asien mit der Lösung.
… sofern derjenige online ist.
Das ist eine Frage der Organisation. Wir finden immer die Zeit für einen sozialen Austausch. Natürlich ist es eine Frage von Geben und Nehmen. Auch ich investiere eine Stunde pro Woche für Anfragen. Ich helfe gern, denn am nächsten Tag brauche ich vielleicht selbst Hilfe aus dem Netzwerk. Diese Art von Zusammenarbeit wird sich in keiner Weise unpersönlich oder „technisch“ anfühlen. Es wird eine Welt sein, in der Wissen, Support und Simulation zum täglichen Leben gehören.
Aber bisher ist das nur eine Vision. Wie können Virtual und Augmented Reality das heutige Lernen unterstützen?
Im Moment kann man in der Welt der Computerspiele viel Spaß mit VR und AR haben. 20 Prozent dieser Produkte sind interessant, aber ich bin mir nicht sicher, wie wirksam sie beim Lernen sind. Mal abgesehen vom „Wow-Effekt“ stellt sich die Frage, ob und wie sie der Mehrheit der Lernenden helfen können. Bei neuen Technologien muss man drei bis sechs Jahre warten, bis sie sich vom Experiment zu einer nützlichen Anwendung entwickeln. Skype beispielsweise gibt es schon seit Jahren, aber erst jetzt wird es beim Distance Learning, im elektronischen Gesundheitswesen und anderen Bereichen eingesetzt. Auf den Philippinen skypen viele Eltern, die auswärts arbeiten, abends mit ihren Kindern und helfen ihnen bei den Hausaufgaben. Wer hätte je gedacht, dass sich Skype mal zu einem weltweiten Tool für Distance Learning entwickeln würde?
Liefern heutige Technologien alles, was wir zum Lernen brauchen? Und wenn nicht, welche Elemente fehlen noch?
Das Design fehlt. Fernsehen gab es schon jahrzehntelang, bevor Spielberg E.T. präsentierte. Wir müssen mehr selbst erleben, ausprobieren, Regeln brechen. Es gibt Menschen, die gerne Kurse auf Basis von Pokémon GO anbieten würden. Aber das ist leider nicht möglich. Wir wissen nicht einmal, wie sich das Spiel zum Lernen nutzen ließe. Es werden keine 20 bis 30 Jahre vergehen, bis wir das herausfinden, aber es wird definitiv mehr als ein paar Monate dauern.
Dank der Hirnforschung haben wir in den vergangenen Jahren viel über das Wesen des Lernens erfahren. Entsprechen die heutigen Technologien diesen Anforderungen, oder anders gefragt: Sind die Tools in der Lage, unseren Hippocampus zu stimulieren?
Wir verstehen jetzt, dass es kognitive Indikatoren gibt, wie jemand lernt. Nun müssen wir erforschen, welche dieser Indikatoren von Personen und Organisationen genutzt werden können. Ich hätte gerne eine Uhr, die mir ins Hirn schaut und mir Feedback zu meinem aktuellen Zustand gibt. Sie würde mir sagen, dass ich im Alter von 66 Jahren nach 17 Uhr keine Artikel mehr schreiben sollte, da meine Performance danach stark nachlässt. Ich hätte gerne einen Indikator, der mir mein Performance-Level wie eine Ampel darstellt: grün, gelb und rot. Und mein E-Mail-Programm sollte mir sagen, dass ich die Mail noch nicht abschicken sollte, weil sie nicht gut genug ist. IBM forscht im großen Stil an kognitiven Technologien. Für mich bedeutet „kognitiv“: Es wird immer eine Online-Hilfe geben, sei es ein familiäres, soziales, gesundheitliches oder freizeitbezogenes Thema.
Können Sie mir ein Beispiel nennen, wie personalisierte Informationen in der Freizeit funktionieren?
Sie gehen zum Beispiel in ein Restaurant: Nach der Gesichtserkennung am Eingang erhalten Sie eine andere Speisekarte als die anderen Gäste, denn sie richtet sich nach Ihren Vorlieben und Ihrem Gesundheitszustand. Um diese Indikatoren zu erhalten, werden wir zur biometrischen Erkennung übergehen. Das ist die einfachste Form des Datenschutzes.
Aber wenn ich diesmal etwas Anderes essen will?
Natürlich können Sie das immer noch selbst entscheiden. Die biometrische Erkennung macht ja nur Vorschläge. Man kann jederzeit zur Standard-Speisekarte wechseln.
Apropos Essen – wird die Technologie je in der Lage sein, jedem von uns eine Speisekarte mit individuellen Wissensnuggets zu servieren?
Das kommt darauf an, wie viel man ausgeben will. Lernen ist ein Marktplatz: Wer kostenlos lernen will, kann nicht aus tausend Möglichkeiten wählen. Aber wenn der Arbeitgeber bereit ist, zu investieren (Geld, Energie, Aufwand, Zeit), kann man diese tausend Auswahlmöglichkeiten bieten. Das ist wie in einer Konferenz: Wenn man für 1600 Teilnehmer ein Frühstück und Mittagessen servieren will, eignet sich ein Buffet am besten. Wenn 30 Leute Allergien oder besondere Wünsche haben, kann man das leicht managen. Aber nicht bei 1600. Das gleiche trifft auf das Lernen zu: Ich kann einen Kurs entwickeln, der für einen Großteil der Lernenden wenig Auswahlmöglichkeiten bietet. Einer kleineren Zielgruppe kann man dann ein individuelles Design anbieten, aber nicht Tausenden von Mitarbeitern weltweit.
Lesen Sie den Artikel auf pressebox.de